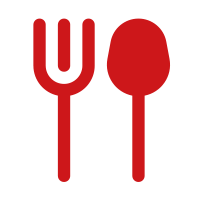Größere Krisen wie Corona, Ukraine-Krieg und Teuerung führen zu einem Anstieg von Angststörungen und Depressionen. Bei den Symptomen und Ursachen gibt es große Geschlechts- und Generationsunterschiede. Wie die Erkenntnisse der Sozialpsychiatrie helfen können, um gegen die Erkrankung anzukämpfen, wird beim derzeit stattfindenden Weltkongress der Psychiatrie im Austria Center Vienna auf den Grund gegangen.
Psychische Erkrankungen sind häufiger als man denkt. Fast ein Viertel der Bevölkerung sind pro Jahr davon betroffen. Dennoch werden psychische Erkrankungen nach wie vor oft tabuisiert. „Daher ist es mir ganz wichtig zu betonen, dass niemand etwas für die Entwicklung einer psychischen Erkrankung kann und sich daher auch nicht dafür zu schämen braucht. Es gibt Hilfe und in den meisten Fällen lassen sich psychische Erkrankungen auch gut behandeln“, betont Univ.-Prof. Dr. Johannes Wancata, Leiter der Klinischen Abteilung für Sozialpsychiatrie an der MedUni.
Wirtschaftskrise als möglicher Auslöser
Generell leiden in Österreich rund 730.000 Menschen an Depressionen. Die anhaltende Teuerungswelle und die vielen negativen Wirtschaftsmeldungen begünstigen zudem generell eine depressive Stimmung. War während der Corona-Pandemie die Suizidrate bei Erwachsenen sogar rückläufig, besteht nun mit den wirtschaftlichen Folgen nach der Pandemie das Risiko, dass die Suizidrate ansteigen könnte. Wissenschaftliche Studien belegen, dass bereits bei 1 % mehr Arbeitslosigkeit die Selbstmordrate um 1,4 % ansteigt. „Länder, die in solchen Situationen mit konkreten Maßnahmen in die Berufseingliederung investieren, können dem aktiv entgegenwirken. Wichtig ist, hier mit Anreizen den Menschen Hoffnung zu geben,“ erklärt Wancata, der sich als Sozialpsychiater stark mit den sozialen Risiken und Faktoren für psychische Erkrankungen beschäftigt.
Männern reagieren anders als Frauen
Depressionen kommen bei Männern seltener vor als bei Frauen. Eine repräsentative Studie in der österreichischen Bevölkerung hat gezeigt, dass 7,4 % der Österreicher und 12,6 % der Österreicherinnen daran leiden. Klassische Symptome für eine Depression bei beiden Geschlechtern sind Energielosigkeit, Niedergeschlagenheit, wenig Freude am Alltag, Schuldgefühle, Rückzug, Isolation und der Wunsch, nicht mehr leben zu wollen. Hinzu kommt besonders bei Männern Reizbarkeit, Aggressivität und Risiko- bzw. Suchtverhalten. Dieses Verhalten kann die klassischen Depressionssymptome überlagern. „Während bei Frauen vor allem zwischenmenschliche Spannungen eine Depression auslösen sind es bei Männern häufig Job- bzw. Partnerschaftsverlust“, verrät Wancata.
Höheres Risiko für pflegende Angehörige
Neueste Studien zeigen, dass Angehörige, die zu Hause psychisch kranke Personen pflegen, ein höheres Risiko haben, selbst eine Depression zu entwickeln. Auslöser hierfür dürfte hier die Zusatzbelastung sein, die ihnen durch die Pflege des Angehörigen entsteht. „Jetzt gilt es, Programme zu entwickeln, wie wir diesen Menschen helfen können,“ so Wancata.
Jugendliche besonders durch Isolation gefährdet
Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist die soziale Identität ganz wichtig. Bei ihnen sind Isolation und Einsamkeit starke Risikofaktoren für die Entwicklung einer Depression. Die Lockdowns und Einschränkungen des sozialen Lebens während der Corona-Pandemie haben sie besonders stark getroffen. „Daher ist es hier jetzt umso wichtiger, sie in ihre gewohnten sozialen Beziehungen zu bringen, persönliche Kontakte zu forcieren und wieder eine gute Zeit- und Tagesstruktur zu organisieren“, betont Wancata.
Ältere Menschen reden nicht gerne darüber
Auch wenn ältere Menschen alleine sind, ist das im Allgemeinen seltener ein Auslöser für eine Depression. Laut Wanka ist das größte Problem bei dieser Bevölkerungsgruppe, dass es ihr schwer fällt, über psychische Erkrankung zu reden und sich Hilfe zu holen. In Pflegeheimen gibt es daher spezielle psychologische Angebote, um Depression und Demenz aktiv anzusprechen.
Angststörungen wegen aktueller Krisen
Je nach Art der gesellschaftlichen Krise nehmen in der Bevölkerung nicht nur depressive Verstimmungen und Depressionen, sondern auch Ängste und Angststörungen zu. Da zum Beispiel der Ukraine-Krieg nicht weit entfernt ist, sind das nachvollziehbare Ängste. „Dass dadurch auch die Ängstlichkeit in der Bevölkerung steigt, ist eine gesunde Reaktion. Leider begünstigt eine so reale Bedrohung bei einigen dann auch die Entwicklung von Angststörungen,“ erklärt Wancata. Bereits einfache Interventionen, die zeigen, wie mit Stress umgegangen werden kann, sind beispielsweise bei Flüchtlingen sehr wirksame Präventionsmaßnahmen, um die Entwicklung von Angststörungen zu verhindern.